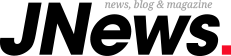Die Wissenschaftlerin Gabriele Berg fordert eine Anpassung der Zulassungsverfahren, um moderne Methoden schneller in der Praxis einsetzen zu können.
Im Bereich des Pflanzenschutzes werden gezielt bestimmte Krankheitserreger bekämpft. „Das eigentliche Problem liegt jedoch oft nicht bei den Erregern selbst, sondern im Fehlen essenzieller Mikroorganismen, die man als ‚Missing Microbes‘ bezeichnet“, erklärt Univ.-Prof. Gabriele Berg von der TU Graz. Sie gehört zu den führenden Expertinnen auf dem Gebiet des Mikrobioms und erforscht die Auswirkungen von mikrobiellen Gemeinschaften auf Pflanzen, Menschen und die Umwelt. „Bereits seit den 1960er-Jahren hat der zunehmende Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien das Bodenmikrobiom erheblich verändert und begünstigt das Auftreten von Pflanzenkrankheiten, für die oft keine klaren Ursachen erkennbar sind.“ Für Berg bedeutet eine gesunde Pflanze daher nicht zwangsläufig auch Gesundheit: „Ein gestörtes Mikrobiom kann bei Menschen Erkrankungen wie Reizdarmsyndrom, Asthma oder sogar Krebs fördern. Das mikrobielle Gleichgewicht ist entscheidend für die Gesundheit sowohl von Pflanzen als auch Menschen.“ Laut Forschung sind bis zu 90 % aller chronischen Krankheiten durch Umweltfaktoren bedingt. „Es geht längst nicht nur um Vitamine oder Antioxidantien – entscheidend ist das Zusammenspiel des gesamten mikrobiellen Ökosystems.“ Diese Erkenntnisse führen zum sogenannten One-Health-Ansatz: Die Gesundheit resultiert aus dem Zusammenwirken zwischen Umwelt, Mensch, Tier und Mikroben. Im Gegensatz zur Landwirtschaft hat die Humanmedizin dies bereits anerkannt.
Veraltetes Zulassungssystem hemmt nachhaltige Innovationen
Trotz erfolgreicher Entwicklungen – wie einer mikrobiellen Saatgutbeize für Zuckerrüben – haben viele Produkte aus ihrem Institut nie den Markt erreicht. „Das ist äußerst bedauerlich, insbesondere da diese Forschungsarbeiten mit öffentlichen Mitteln gefördert werden“, kritisiert sie scharf. Der Grund dafür sei ein überholtes Zulassungssystem, das vor allem auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ausgelegt sei. Mikrobielle Wirkstoffe würden fälschlicherweise wie synthetische Pestizide behandelt – obwohl sie biologischer Natur sind und geringere Risiken bergen könnten. Der Rückgang an zugelassenen chemischen Mitteln sowie die Klimakrise erhöhen den abiotischen Stress im Pflanzenschutz erheblich; gleichzeitig sieht Berg hierin eine Chance für ein neues zentralisiertes EU-Zulassungsverfahren für biologische Produkte nach US-Vorbild , welches Innovationen deutlich schneller verfügbar machen könnte. Aktuell arbeitet sie an der Entwicklung microbiom-basierter Biostimulanzien zur Förderung der Bodengesundheit sowie letztendlich auch der menschlichen Gesundheit.
Nachhaltige Produktion kommt allen zugute
Biotechnologische Analysen offenbaren zunehmend tiefgreifende Zusammenhänge in diesem Bereich: „Die industrielle Landwirtschaft muss neu gedacht werden“, fordert Berg vehement Unterstützung durch politische Maßnahmen zur Lösung struktureller Krisen in diesem Sektor einzugehen .„Die gegenwärtige Nahrungsmittelproduktion berücksichtigt nicht ausreichend Folgekosten für Umwelt und Gesellschaft – etwa steigende Gesundheitskosten aufgrund chronischer Krankheiten –, was man jedoch nicht allein den Landwirten zuschreiben kann.“ Zudem werde andere wichtige Leistungen wie Landschaftsschutz oder Biodiversität häufig unzureichend honoriert . Ein positives Beispiel sieht sie in der biologischen Landwirtschaft: Diese erweist sich als widerstandsfähiger sowie besser regional angepasst – selbst wenn dies möglicherweise geringere Erträge mit sich bringt . Ziel sollte es sein ,ein lokales nachhaltiges Agrarsystem aufzubauen ,das gesunde Lebensmittel produziert . „Eine schrittweise Ökologisierung integrierter Produktionsmethoden unter Einbeziehung mehrerer Mikroorganismen sowie alternativer biologischer Pflanzenschutzmittel wäre sinnvoll umsetzbar“ ergänzt Brigitte Kranz , Geschäftsführerin vom IBMA Deutschland-Österreich.
Univ.-Prof.in Gabriele Berg lehrt an der TU Graz am Institut für Umweltbiotechnologie
und leitet zudem die Abteilung Mikrobiom-Biotechnologie am Leibniz-Institut Potsdam.
Im Jahr 2025 wird ihr zudem der Wissenschaftspreis seitens Österreichs Forschungsgemeinschaft (ÖFG) verliehen .
www.ibma-da.org
Längere Version des Interviews sowie Pressebilder stehen bereit.
Pressekontakt:
PURKARTHOFER PR | +43-664-4121491 | info@purkarthofer-pr.at