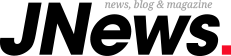Die US-Wirtschaft hat ein massives Beschäftigungsproblem. Im August entstanden laut Bureau of Labour Statistics nur 22.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft, deutlich weniger als die erwarteten 75.000. Zugleich kletterte die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent und übertraf damit erstmals seit 2021 die Zahl der offenen Stellen. Auch Rückrechnungen der Vormonate zeigten: Der tatsächliche Stellenzuwachs lag noch tiefer als bisher angenommen.
Diese Zahlen erschüttern das Vertrauen in die wirtschaftliche Stärke der Vereinigten Staaten und bringen die US-Notenbank unter Zugzwang. Denn die Fed verfolgt ein doppeltes Mandat: Preisstabilität und maximale Beschäftigung. Während sich die Inflation zuletzt bei 2,7 Prozent stabilisierte, ist nun der zweite Pfeiler der Geldpolitik ins Wanken geraten. Ein Handeln der Federal Reserve gilt daher als unausweichlich.
Wie stark fällt die Zinssenkung aus?
Nach monatelangem Zögern verdichten sich die Zeichen, dass Fed-Chef Jerome Powell zur Zinssenkung übergehen wird. In seiner Rede Ende August ließ er durchblicken, dass der Arbeitsmarkt nicht länger ignoriert werden könne. Auch andere Experten signalisierten, dass eine „Anpassung der geldpolitischen Haltung“ bevorstehen könnte.
Die Spekulationen drehen sich inzwischen weniger um das „ob“, sondern fast ausschließlich um das „wie stark“. Während einige Analysten von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgehen, plädiert eine wachsende Zahl von Ökonomen für einen deutlicheren Schritt um 50 Basispunkte. Standard Chartered etwa spricht von einem „Aufhol-Cut“, um die Schwäche des Arbeitsmarkts zu kompensieren. Banken wie Morgan Stanley und die Deutsche Bank bleiben hingegen vorsichtiger. Sie halten zwar eine Senkung für wahrscheinlich, rechnen aber mit kleinen Schritten über mehrere Sitzungen verteilt.
Politischer Druck wächst: Fed-Unabhängigkeit auf dem Prüfstand
Gleichzeitig wächst der politische Druck auf die Notenbank erheblich. US-Präsident Donald Trump macht keinen Hehl daraus, dass er Zinssenkungen fordert, und das möglichst schnell und deutlich. In sozialen Netzwerken wie Truth Social attackiert er Powell persönlich. Der Vorwurf: Die Fed handle zu zögerlich, gefährde das Wachstum und schade damit seiner wirtschaftlichen Erfolgsbilanz vor den Wahlen 2026.
Trump geht sogar noch weiter. Er ließ zuletzt die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen. Auch die BLS-Chefin Erika McEntarfer musste ihren Posten räumen. Zugleich bringt sich Kevin Hassett, Trumps Wirtschaftsberater und möglicher Nachfolger Powells, in Stellung, obwohl er öffentlich betont, dass die Fed frei von politischem Einfluss bleiben müsse. Die Unabhängigkeit der Zentralbank steht damit stärker unter Druck als je zuvor.
Bitcoin: Lockere Geldpolitik als Kurstreiber
Für den Kryptomarkt hat diese Gemengelage eine positive Wirkung: Lockerung der Geldpolitik bedeutet mehr Liquidität, geringere Anleiherenditen und gesteigertes Interesse an risikobehafteten Anlagen. Bitcoin konnte bereits im August von den ersten Zinssenkungsfantasien profitieren und auf ein neues Allzeithoch über 124.000 US-Dollar steigen.
Ein moderater Zinsschritt von 25 Basispunkten könnte dem Markt kurzfristige Stabilität bringen. Sollte die Fed den Leitzins jedoch gleich um 50 Basispunkte senken, wäre das ein starkes Signal. Investoren könnten dies als Auftakt für eine längere Phase geldpolitischer Lockerung interpretieren. Ein solches Szenario dürfte nicht nur Bitcoin beflügeln, sondern auch Altcoins und Aktien im Tech-Sektor Rückenwind verschaffen.
Langfristig stellt sich allerdings die Frage, ob ein durch politische Motive getriebener Zinskurs dem Vertrauen in den US-Dollar und dem gesamten Finanzsystem schadet. In jedem Fall dürften volatile Wochen bevorstehen, für die Märkte ebenso wie für die Fed.