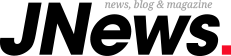Der Bundesrechnungshof (BRH) hat die finanzielle Situation der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) analysiert. Laut seiner Einschätzung sind vor allem strukturelle Probleme verantwortlich für das Fehlen von Finanzreserven bei den Krankenkassen. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) stimmt dieser Analyse zu, äußert jedoch deutliche Bedenken in einem entscheidenden Punkt: Die Empfehlung des BRH, sich zur kurzfristigen Einsparung auf das Gutachten des Sachverständigenrats (SVR) zu stützen, wird von der pharmazeutischen Industrie als gefährlich erachtet: „Eine fortlaufende Senkung der Arzneimittelpreise schwächt nicht nur die Innovationskraft unserer Unternehmen, sondern ignoriert auch die volkswirtschaftlichen Konsequenzen und gefährdet letztlich die Patientenversorgung“, warnt Dr. Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des BPI. „Die Ursachen und Lösungen für die finanziellen Schwierigkeiten der GKV müssen an anderer Stelle gesucht werden“, betont Joachimsen.
Dringende Reformen zur Finanzierung der GKV notwendig
„Ein Beispiel für unzureichende Strukturfinanzierung ist die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern – diese belastet die GKV jährlich mit etwa zehn Milliarden Euro. Das ist sowohl strukturell als auch systemisch problematisch. Momentan wird dies durch Versicherte und Arbeitgeber querfinanziert. Wie Bundesgesundheitsministerin Nina Warken richtig festgestellt hat, ist es dringend erforderlich, dass Kosten gesamtstaatlicher Aufgaben aus dem GKV-System herausgenommen werden; diese sollten vollständig steuerfinanziert sein“, hebt Joachimsen hervor. „Stattdessen erleben wir lediglich kurzfristige Nothilfen wie rückzahlungspflichtige Darlehen, welche den Druck auf das System weiter erhöhen.“
Ausgabenentwicklung im Kontext betrachten
Der BRH weist insbesondere auf steigende Ausgaben bei patentgeschützten Arzneimitteln hin; doch laut BPI:
„Obwohl hochinnovative Therapien zunächst teuer erscheinen mögen, entlasten sie langfristig erheblich unser Gesundheitssystem – sie verhindern tödliche Krankheitsverläufe oder lindern schwere Leiden.“ Darüber hinaus trägt unsere Branche seit Jahren signifikant zur Stabilität der GKV bei. Dennoch entsteht immer wieder der Eindruck, dass Arzneimittel das Hauptproblem darstellen – dabei liegt ihr Anteil an den Gesamtausgaben gesetzlicher Krankenkassen seit Jahren konstant bei etwa elf Prozent nach Abzug aller Handelsstufen.“ Mehr als 35 Preisinstrumente belasten mittlerweile unsere Branche stark – unsere Unternehmen kämpfen gegen ein Übermaß an Regulierung,“ kritisiert Joachimsen.
- Rabattverträge entlasten Kassen jährlich um nahezu sechs Milliarden Euro.
- Dank Erstattungsbeträgen (AMNOG), steigen Einsparungen von 144 Millionen Euro im Jahr 2013 voraussichtlich auf 7,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024.
- Mithilfe Zwangsabschläge, zahlte die Industrie im Jahr 2023 zusätzliche 2,8 Milliarden Euro; auch im Jahr 2024 werden es noch rund 1,7 Milliarden Euro sein.
- Festbeträge, sorgen seit über drei Jahrzehnten für jährliche Einsparungen in Höhe von rund acht Milliarden Euro.
BPI-Position zum SVR-Gutachten
„Das Gutachten des Sachverständigenrats bietet zwar einige positive Ansätze – wie eine verstärkte Digitalisierung im Gesundheitswesen oder gezielte Förderung klinischer Forschung -, jedoch stehen viele tiefgreifende Eingriffe in den Arzneimittelpreisbildungsprozess klar im Widerspruch zu zentralen Zusagen aus dem Koalitionsvertrag.“ Gerade jetzt benötigt Deutschland einen Investitionsschub in dieser Schlüsselindustrie,“ ergänzt Joachimsen.
Empfehlungen des Bundesverbands Pharmazeutische Industrie:
- Sicherung des Marktzugangs: Eine freie Preisbildung beim Markteintritt neuer Medikamente ist entscheidend für deren frühzeitige Verfügbarkeit in Deutschland – Interimspreise könnten den Zugang zu neuen Therapien verzögern.
- Erschaffung von Planungssicherheit: Eine verbindliche und frühzeitige Festlegung einer Vergleichstherapie schafft Verlässlichkeit für Studien sowie Nutzenbewertungen und Preisverhandlungen.
- Achtung seltener Erkrankungen: Der Zusatznutzen von Medikamenten gegen seltene Krankheiten muss weiterhin automatisch anerkannt werden; andernfalls drohen Rückschritte in Forschung und Versorgung betroffener Patienten.
- Noch keine verdeckte Rationierung durch Schwellenwerte:
Kosten-Nutzwert-Bewertungen sollten gezielt eingesetzt werden – routinemäßige Anwendungen schaffen Hürden. - Bessere Balance bei Preisverhandlungen:
Entscheidungen über Erstattungsfähigkeit dürfen nicht allein beim GKV-Spitzenverband liegen – vielmehr sollte eine stärkere Verhandlungsposition für Hersteller geschaffen werden. - Anstreben innovationsfreundlicher Vergütung:
Schrittinnovationen müssen honoriert sowie Preismodelle wie Zahlung nach Leistung sollten gesetzlich verankert werden. - Sorgfältige Neubewertung zusätzlicher Nutzen:
Es bestehen bereits gesetzliche Möglichkeiten; permanente Neubewertungen sind weder realistisch noch praktikabel. - Klarstellung gegen Arzneimittelbudgets:
Diese würden Innovationsanreize hemmen sowie AMNOG entwerten und implizit zur Rationierung führen. - Flexible Preisanpassungen bereits möglich : Das bestehende System erlaubt dynamische Anpassungen , zusätzliche Instrumente sind daher unnötig .
- Standort stärken : Bürokratie abbauen , digitale Forschungsinfrastruktur erweitern , steuerfinanzierte Förderung sichern .
- Pharma als Leitindustrie anerkennen : Medikamente sollten nicht nur als Kosten betrachtet , sondern vielmehr als Investition in Gesundheit sowie Wirtschaft verstanden werden .
Pressekontakt:
Lara Perotti (Stellvertretende Pressesprecherin),
Tel.:03027909-131,lperotti@Bpi.de