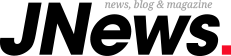Die aktuellen Entwicklungen im deutschen Stromnetz senden eine klare Botschaft: Die Energiewende steht vor einer ernsthaften Herausforderung, wenn es an der notwendigen Speicherinfrastruktur mangelt. Am 19. und 20. März 2025 kam es zu außergewöhnlichen Schwankungen in der Netzfrequenz, die massive Eingriffe seitens der Netzbetreiber erforderlich machten, um einen Systemzusammenbruch abzuwenden.
Der Dienst zur Überwachung der Netzfrequenz meldete am 19. März erstmals offiziell eine „angespannte Situation im Verbundnetz“. Zwischen Mittag und Abend schwankte die Frequenz erheblich, mit Werten über 50,1 Hertz und Rückgängen unter 49,9 Hertz – gefährlich nah an den automatischen Notabschaltgrenzen.
Von Mangel zu Überfluss in Rekordzeit
Am Vormittag fehlten zeitweise 1.900 Megawatt, was fast zwei Atomkraftwerken entspricht. Nur wenige Stunden später wies das Netz jedoch einen Überschuss von 1.595 Megawatt auf. Solche extremen Schwankungen stellen für die Betreiber des Netzes eine erhebliche Herausforderung dar: Um einen Blackout zu verhindern, mussten innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Großanlagen gezielt heruntergefahren werden.
An diesem Tag wurden allein in Bayern etwa 2.600 Photovoltaikanlagen vom Netz genommen aufgrund eines historischen Einspeiserekords: Mehr als 43.700 Megawatt Solarstrom speisten gleichzeitig ins Netzwerk ein. Innerhalb von nur 15 Minuten änderte sich die Einspeisung um mehr als 3.000 Megawatt, was dem abrupten Zu- oder Abschalten dreier großer Kraftwerke entspricht; über einen Zeitraum von einer Stunde betrug die Veränderung sogar 12.600 Megawatt, was acht bis neun Atomkraftwerken gleichkommt.
Kritische Redispatch-Maßnahmen auf Rekordniveau
Zur Stabilisierung des Netzes greifen die Übertragungsnetzbetreiber auf sogenannte Betriebsanpassungsmaßnahmen (Redispatch). Hierbei werden Erzeugungsanlagen gezielt hoch- oder heruntergefahren, um Engpässen entgegenzuwirken.
Bis zum besagten Datum gab es bereits insgesamt 4.485 solcher Eingriffe, verglichen mit nur 3 .861 im Vorjahr – ein Anstieg von über 16 %. Die abgeregelte Energiemenge stieg ebenfalls an – von5 ,7 Terawattstunden auf6 ,2 Terawattstunden
Preisschwankungen an den Strommärkten
Die Schwankungen im Stromnetz hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Preise am Markt.
Am
20 .März reichten diese zwischen0 ,4 Euro pro megawattstunde
und
280 Euro – ein Preisanstieg um das
700-Fache innerhalb weniger Stunden.
Am
19.März waren sogar mehrere Stunden lang negative Preise verzeichnet worden,
gefolgt von einem plötzlichen Anstieg auf250 Euro.
Solche extremen Preisschwankungen sind direkte Indikatoren für mangelnde Flexibilität im Energiesystem.
Ohne Speicher müssen Überschüsse oft ungenutzt abgeregelt werden,
während bei Unterversorgung kurzfristig teure Reservekraftwerke aktiviert werden müssen.
Strukturelles Problem: Fehlende Transport- und Speicherinfrastruktur
Deutschland produziert zunehmend Energie aus erneuerbaren Quellen – jedoch nicht immer dort oder dann,
wo sie benötigt wird.
Die Übertragungsnetze sind vielerorts stark ausgelastet;
der Transport von Windenergie aus dem Norden in den Süden oder Sonnenenergie aus dem Süden in den Norden ist eingeschränkt.
Folge dieser Situation ist häufig eine „dunkelrote“ Kennzeichnung auf den Karten zur Netzbelastung;
Überschüsse können nicht abfließen,
was Zwangsabschaltungen nach sich zieht.
Besonders kritisch wird es,
wenn Hochspannungsleitungen abgeschaltet werden müssen –
hier droht innerhalb weniger Minuten ein Blackout.
Blackout-Gefahr: Horrorszenario oder reale Bedrohung?
Obwohl offiziell oft relativiert wird,
besteht laut Experten zunehmend das Risiko lokaler Stromausfälle –
insbesondere während Wochenenden und Feiertagen mit geringer Nachfrage sowie gleichzeitig hoher Erzeugungsspitze.
Das Szenario sieht wie folgt aus:
Scheint während Ostern ganztägig Sonne ,
fällt der Verbrauch unter40 Gigawatt ,
während Produktion durch Photovoltaik und Windkraft weit darüber liegt.
Wenn Betreiber des Netzes in solch einer Lage nicht alle kritischen Anlagen fernsteuern können ,
bleibt oftmals nichts anderes übrig als ganze Bereiche abzuschalten –
mit weitreichenden Folgen für Industrie ,
Infrastruktur sowie Privathaushalte .
GEPVOLT SE: Batteriespeicher als Schutzschild gegen Instabilität
„Für das Gelingen der Energiewende ist es entscheidend,
dass wir technische Lösungen finden zur Ausgleichung zwischen Erzeugungsspitzen sowie Verbrauchslücken .
Batteriespeicher sind dabei nicht nur hilfreich –
sie sind unverzichtbar“, so Franz Schnorbach , Vorstandsvorsitzender bei GEPVOLT SE .
Das Unternehmen entwickelt großskalige Batteriespeichersysteme ,
die binnen Sekundenbruchteilen reagieren können .
Sie speichern überschüssigen Strom bei hoher Produktion
und geben ihn bedarfsgerecht wieder ab –
ohne CO2-Ausstoß fossiler Reservekraftwerke .
Vorteile unserer GEPVOLT-Batteriespeicher:
- Schnelle Stabilisierung des Netzes: Reaktionszeiten im Millisekundenbereich verhindern kritische Frequenzabweichungen.
- Einsparpotential durch Abregelungsvermeidung: Jeder gespeicherte Überschuss reduziert teure Notabschaltungen.
- Sicherheit bei Versorgung: Regionale Engpasssituationen lassen sich abfedern, Blackouts vermeiden.
- Kosteneffizienz: Extreme Preissprünge am Markt können minimiert werden.
- C02-Reduktion:< ;Weniger Einsatz fossiler Reservekraftwerke > ;</ li > ;
< ;/ ul > ;